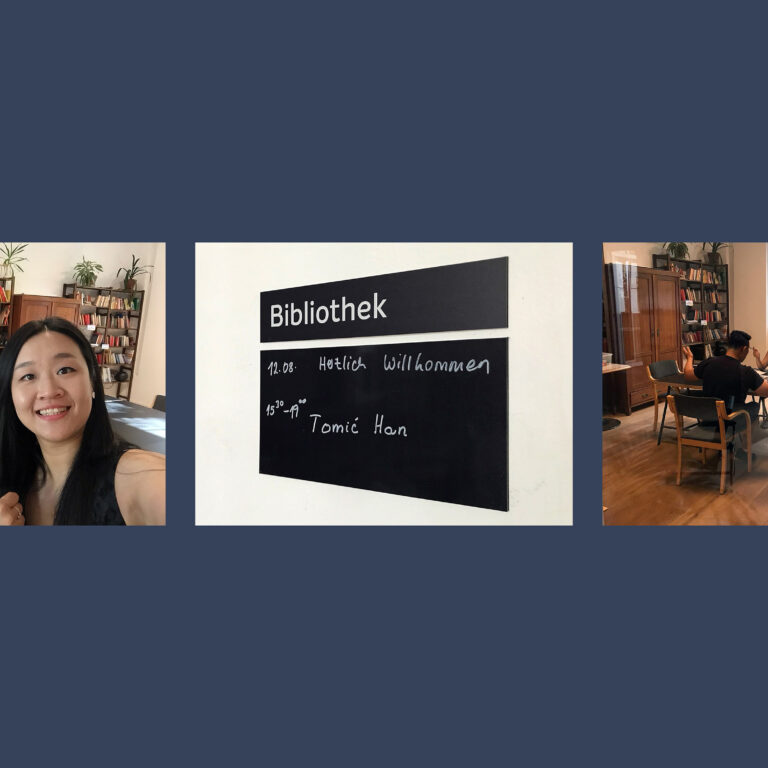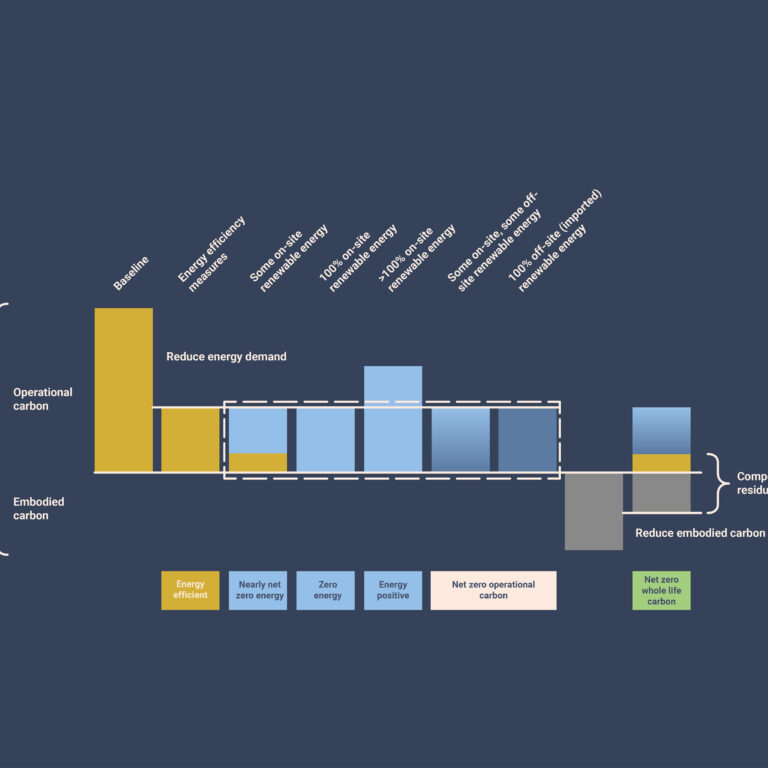Wir leben in einer Zeit, in der Architekt:innen mehr Energie darauf verwenden, ihre Werkzeuge neu zu erfinden, als sie zu benutzen.
Der Stift — einst eine bescheidene Brücke zwischen Gedanke und Materie — wurde immer wieder neu geboren. Er wurde als digitale Eingabe durch den Aufstieg der Computer neu erfunden, verbarg sich hinter CAAD, verschmolz mit dem BIM-Prozess und tritt heute als KI auf. Jede Wiedergeburt kommt mit denselben Versprechen: Befreiung, Revolution, ja sogar Erlösung. Und doch bleibt er unter dem Kostüm, was er immer war — ein Instrument der Schöpfung, das auf die Hand und den Geist eines Schöpfers wartet, der etwas zu sagen oder zu hinterlassen hat.
Der Stift ist das Werkzeug, und Werkzeugmacher machen Werkzeuge. Ihr Beruf ist das Instrument. Unser Beruf ist der Akt des Entwerfens. Diese Rollen zu verwechseln, heißt, Architektur selbst zu verwechseln. Ist man Architekt des Raumes, oder Architekt von Werkzeugen für andere Architekten? Beides mag den Titel „Architekt“ rechtfertigen — aber Architekt von was? Macht es Sinn, Architekt eines Pfannkuchens zu sein? Ein guter Pfannkuchen kann zweifellos vom Geist eines Architekten geschaffen werden, und eine solche Kreation kann zum Geschäft werden. Natürlich ist es möglich, ein Geschäft zu führen, das eines, beides oder alles produziert.
Früher, wenn Architekt:innen ihre Werkzeuge kommentierten, dann nicht, weil sie diese herstellen wollten, sondern weil sie sie intensiv nutzten — sie kannten ihre Grenzen, ihren Widerstand, ihre Möglichkeiten. Dieses Feedback war wertvoll. Doch in dem Moment, in dem ein Architekt die Schöpfung aufgibt, um Werkzeuge zu bauen, hört er auf zu entwerfen. Er überschreitet die Grenze zum Handwerk, Architekt von Werkzeugen zu sein. Daran ist nichts falsch. Aber: Ein Koch, der sehr erfolgreich Messer entwirft und produziert, ist nicht automatisch der bessere Koch, nur weil er seine eigenen Messer nutzt. Ein anderer Koch mag von diesen Messern profitieren — oder auch nicht.
Ob man in Ton modelliert, auf Papier skizziert, 3D-druckt oder ein LLM füttert, ist zweitrangig. Das Medium ist ein Mittel, nicht das Wesen. KI, so erstaunlich sie auch sein mag, bleibt ein Recycler: ein Virtuose der Fragmente, der endlos collagiert, was bereits geschaffen wurde. Nützlich? Ja. Faszinierend? Gewiss. Aber Frankenstein-Architektur, so raffiniert sie auch sein mag, bleibt Frankenstein.
Architektur ist keine Montage. Sie ist Schöpfung, die von innen herausbricht und zur Form kristallisiert — sie trägt Farbe, Geruch, Rhythmus, Resonanz. Sie schreit ihre eigene Seele in den Raum. Leere Hüllen, aus Fragmenten zusammengesetzt, mögen Gebäuden ähneln, bleiben jedoch hohl.
Die wahre Gefahr liegt nicht im Werkzeug selbst, sondern in unserem Gehorsam gegenüber ihm. Wenn wir uns ergeben, verengt sich die Spirale: effiziente Boxen, ökologische Boxen, optimierte Boxen, populäre Boxen — endlos wiederholt, endlos identisch. Eine Geometrie des Nichts, getarnt als Fortschritt.
KI wird bleiben, und das soll sie auch. Sie ist ein außergewöhnliches Werkzeug, und als solches kann sie nur das Bestehende recombinieren. Ohne frische Schöpfung, ohne Köpfe, die bereit sind, aus den Fragmenten herauszutreten, bleibt nichts übrig, was sie zerlegen könnte.
Unsere Aufgabe als Architekt:innen hat sich nicht verändert: das Richtige zu schaffen, nicht das, was das Werkzeug gut ausführt. Das Werkzeug entwirft nicht. Wir tun es.
Ob wir es heute KI nennen, morgen LLMs oder übermorgen SAI — das Etikett spielt keine Rolle. Ohne neue Schöpfung, die zerschnitten und recombiniert werden kann, zieht sich die Spirale nur enger — bis nichts bleibt außer Effizienz ohne Seele.